Die Meldung der sogenannten “Enhanced Games” in Las Vegas, bei denen jegliche Form des Dopings erlaubt sein wird, um Athlet:innen “grenzenlose Leistung” zu ermöglichen, sorgt derzeit weltweit für Aufsehen. Die Vision eines Wettkampfes ohne Anti-Doping-Regeln wirkt wie ein dystopisches Science-Fiction-Szenario – oder wie ein Rückschritt in eine Zeit, in der Leistung um jeden Preis zählte. Diese Debatte lenkt auch im Volleyball den Blick auf ein Thema, das dort bisher vergleichsweise wenig Beachtung fand: Doping und Medikamentenmissbrauch.
Doping im Volleyball: Kein Massenphänomen, aber dennoch existent
Volleyball ist ein Sport, der eher durch Technik, Spielintelligenz und Teamwork als durch Maximalkraft oder Ausdauer definiert ist. Dennoch bedeutet das nicht, dass Doping keine Rolle spielt. Die bisher geringe Zahl an Fällen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch im Volleyball leistungssteigernde oder belastungsreduzierende Mittel zum Einsatz kommen können – und teilweise auch kommen.
Die Faktenlage in Deutschland
Laut der Nationalen Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) lag der Anteil der Dopingkontrollen im Volleyball (als Teil der Mannschaftssportarten) zwischen 2016 und 2019 bei etwa 5 bis 9 % der Gesamtzahl der Tests. Das ist vergleichsweise gering, deutet aber auf eine bewusste Risikoeinschätzung hin: Volleyball gilt nicht als Hochrisikosport für Doping. Dennoch sind Tests notwendig und sinnvoll, denn sie sichern die Integrität des Sports.
Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) steht klar für einen dopingfreien Sport und hat dies in seiner Anti-Doping-Ordnung verankert. Diese basiert auf dem Welt Anti-Doping Code (WADC) und dem Nationalen Anti-Doping Code (NADC) und umfasst:
- Prävention und Aufklärung über Programme wie “Gemeinsam gegen Doping“
- Regelmäßige Trainings- und Wettkampfkontrollen
- Rechtliche Absicherungdurch das Anti-Doping-Gesetz
Internationale Dopingfälle
Auch international ist Volleyball nicht frei von Doping. Der wohl bekannteste Fall ist die chinesische Nationalspielerin Yang Fangxu, die 2019 wegen EPO-Missbrauchs für vier Jahre gesperrt wurde. Auch der kasachische Beachvolleyballspieler Alexandr Dyachenko wurde 2018 positiv auf Meldonium getestet und für zwei Jahre gesperrt.
In Europa erregte 2003 der Fall des deutsch-slowakischen Spielers Lukas Diviš Aufsehen, der wegen Nandrolon-Missbrauchs für zwei Jahre gesperrt wurde. Weitere Fälle, wie der des Russen Dmitry Barsouk (Testverweigerung) oder vage Verdachtsmomente gegen Spieler wie Nikita Liamin, zeigen, dass auch im Beachvolleyball Risiken bestehen.
Besonders bemerkenswert aus deutscher Sicht ist der Fall von Stefan Uhmann, einem deutschen Beachvolleyballer, der 2009 wegen Doping mit einem Stimulans gesperrt wurde. Er bleibt einer der wenigen dokumentierten Fälle im deutschen Volleyball.
Dopingmethoden: Was könnte im Volleyball eine Rolle spielen?
Obwohl Volleyball nicht dieselben physiologischen Anforderungen wie Radsport oder Gewichtheben stellt, gibt es potenzielle Anwendungsbereiche für verschiedene Dopingmittel:
- Anabole Steroide (z. B. Testosteron, Nandrolon) zur Steigerung von Sprungkraft und Schnellkraft
- Beta-2-Agonisten wie Clenbuterol zur Muskeldefinition
- Wachstumshormone (HGH) für Regeneration und Muskelaufbau
- EPO oder Blutdoping zur Ausdauersteigerung bei Turnierbelastungen
- Stimulanzienwie Ephedrin oder Amphetamine für Fokus, Reaktionsfähigkeit und mentale Leistungsbereitschaft
- Kortikosteroide zur Schmerzunterdrückung
In der Praxis kommen viele dieser Mittel aber nur in Ausnahmefällen zum Einsatz – was bleibt, ist eine andere, subtilere Form des Missbrauchs: die unkontrollierte oder zweckentfremdete Einnahme von Medikamenten.
Medikamentenmissbrauch im Volleyball: Die stille Gefahr
Viel häufiger als Doping im engeren Sinne ist im Volleyball der Medikamentenmissbrauch. Besonders in unteren Leistungsklassen oder im Amateursport wird oft ohne medizinische Begleitung zu Medikamenten gegriffen, um Schmerzen zu lindern oder trotz Erschöpfung zu funktionieren.
1. Schmerzmittel (Analgetika)
Substanzen wie Ibuprofen, Diclofenac oder Paracetamol sind weit verbreitet. Oft werden sie präventiv eingenommen, um aufkommende Schmerzen zu unterdrücken. Die Risiken sind erheblich:
- Nierenschäden
- Magen-Darm-Blutungen
- Maskierung chronischer Beschwerden
2. Kortisonpräparate
In Form von Injektionen oder Tabletten helfen Prednisolon und Co. bei Entzündungen. Wiederholte Injektionen in Gelenke vor wichtigen Spielen sind jedoch problematisch und können:
- Knorpel schädigen
- Das Immunsystem schwächen
- Osteoporose fördern
Zudem gelten viele Kortison-Präparate je nach Verabreichungsform als dopingrelevant und erfordern eine TUE (Therapeutische Ausnahmegenehmigung).
3. Stimulanzien
Koffein in hohen Dosen, Ephedrin oder sogar Amphetamine werden gelegentlich genutzt, um die mentale Leistung zu steigern. Hier drohen:
- Herz-Kreislauf-Probleme
- Schlafstörungen
- Abhängigkeit
4. Psychopharmaka / Beruhigungsmittel
Zur Bekämpfung von Wettkampfangst greifen einige Athlet:innen zu Benzodiazepinen (z. B. Diazepam). Dies kann kurzfristig hilfreich erscheinen, birgt aber hohe Risiken:
- Abhängigkeit
- Reaktionsverlangsamung
- Entzugserscheinungen
5. Substanzen zur Regeneration
In Grauzonen bewegen sich auch einige Wachstumsförderer oder Nahrungsergänzungsmittel, die zur schnelleren Regeneration nach Verletzungen verwendet werden. Diese Mittel können unerlaubt leistungssteigernd wirken und damit gegen Dopingregeln verstoßen.
Die Rolle der Aufklärung
Programme wie “Gemeinsam gegen Doping” (NADA) leisten wichtige Arbeit, um Athlet:innen, Trainer:innen und Eltern zu sensibilisieren. Besonders im Jugend- und Amateursport fehlt es oft an medizinischer Betreuung und Wissen um Risiken. Hier ist es entscheidend, dass die Grenzen zwischen Therapie, Prävention und Missbrauch klar kommuniziert werden.
Fazit: Wachsamkeit statt Panik
Volleyball ist kein “Dopingproblem-Sport” – das ist die gute Nachricht. Doch in Zeiten, in denen selbst Wettkämpfe wie die Enhanced Games den offenen Einsatz von Doping zu legitimieren versuchen, braucht es klare Haltungen. Auch im Volleyball gibt es Missbrauch – sei es durch Schmerzmittel, Stimulanzien oder andere Medikamente. Die Dunkelziffer ist schwer zu erfassen.
Deshalb braucht es weiter:
- Systematische Aufklärung
- Verantwortungsvolle medizinische Begleitung
- Kritisches Bewusstsein der Athlet:innen
- Klare Sanktionen bei Verstößen
Denn Gesundheit, Fairness und Respekt sollten auch im Volleyball oberstes Ziel bleiben.
Disclaimer: Medikamentenmissbrauch im Sport
Die Inhalte oben dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wir verurteilen ausdrücklich jeglichen Missbrauch von Medikamenten und leistungssteigernden Substanzen im Sport. Die Verwendung verschreibungspflichtiger oder verbotener Substanzen ohne medizinische Indikation und ärztliche Aufsicht kann erhebliche gesundheitliche Risiken mit sich bringen und ist in vielen Fällen gesetzlich sowie sportrechtlich verboten.
Wir sprechen uns entschieden gegen Doping und unsachgemäßen Medikamentenkonsum aus. Ziel dieser Informationen ist es, über die Gefahren und Konsequenzen von Medikamentenmissbrauch im sportlichen Kontext aufzuklären – nicht, deren Anwendung zu fördern oder zu verharmlosen.
Sport sollte stets im Zeichen von Fairness, Gesundheit und Respekt gegenüber sich selbst und anderen stehen.
Bei Fragen oder gesundheitlichen Problemen wenden Sie sich bitte an qualifiziertes medizinisches Fachpersonal.

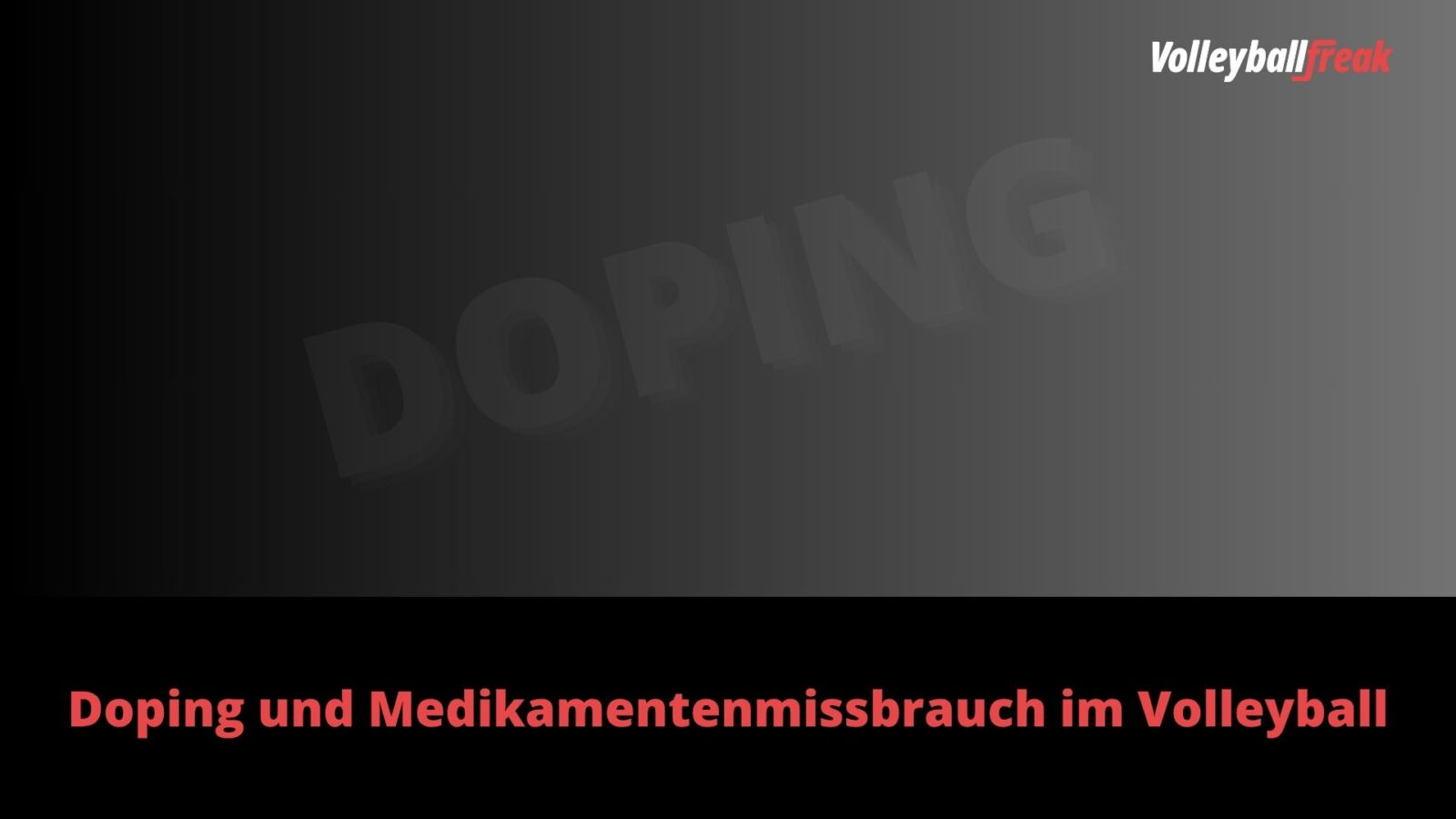
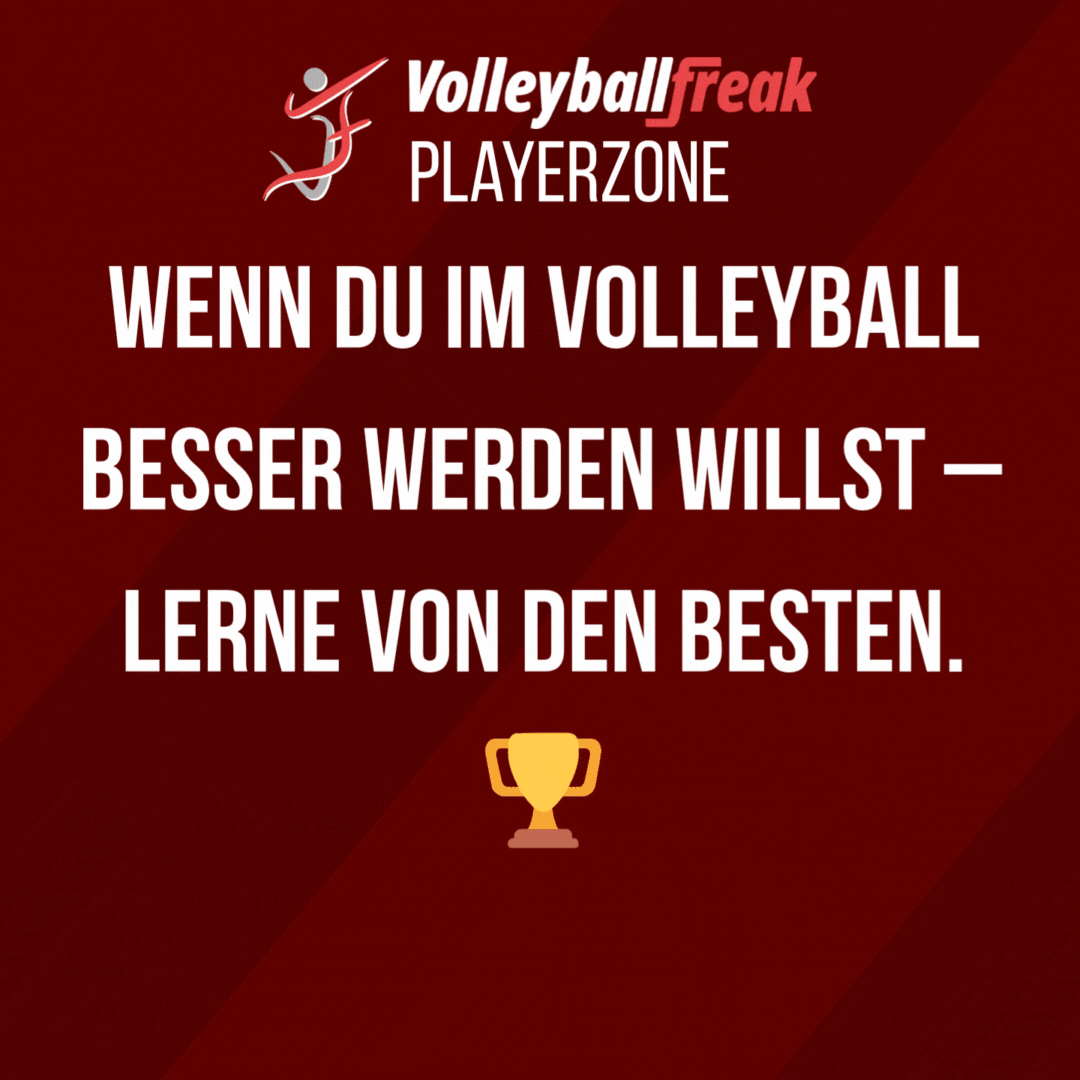
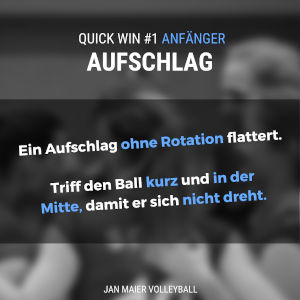
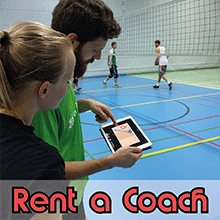



 Mein Name ist Steffen Probst. Ich bin ein leidenschaftlicher Volleyballer, Schiedsrichter und Fan.
Mein Name ist Steffen Probst. Ich bin ein leidenschaftlicher Volleyballer, Schiedsrichter und Fan.