Die Menstruation und der weibliche Zyklus sind im Leistungssport lange ein Tabuthema gewesen. Doch zum Glück ändert sich das! Immer mehr Studien zeigen, wie stark das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Athletinnen durch die hormonellen Schwankungen ihres Zyklus beeinflusst werden können. Zwei aktuelle Forschungsarbeiten haben sich speziell mit Volleyballerinnen beschäftigt und liefern wertvolle, wenn auch unterschiedliche, Erkenntnisse für den Trainingsalltag.
In dieser vertieften Analyse fassen wir die beiden Studien detailliert für dich zusammen, inklusive aller wichtiger statistischer Kennzahlen. Anschließend leiten wir daraus klare, praxistaugliche Empfehlungen ab – für Spielerinnen und Trainer:innen gleichermaßen.
Studie 1: Die deutsche Tracking-Studie – Eine Bestandsaufnahme bei Profis
Die Studie „Menstrual cycle tracking in professional volleyball athletes“ (Roffler et al., 2024) verfolgte das Ziel, die Vielfalt der Menstruationszyklus-Symptome (MCS) und deren Häufigkeit innerhalb eines gesamten Profi-Teams zu charakterisieren.
Methodik im Detail:
- Teilnehmerinnen:20 Volleyballerinnen der ersten deutschen Bundesliga (Durchschnittsalter: 24,5 ± 2,0 Jahre).
- Tracking-Dauer:Zwischen 4 und 20 Monaten während der Wettkampfsaisons 2019/2020 und 2020/2021.
- Tool:Verwendung der FitrWoman®-App, in der die Athletinnen täglich ihre Blutung und das Auftreten von 18 vordefinierten Symptomen protokollierten.
- Auswertung:Berechnung eines Menstrual Symptom Index (MSI) nach Bruinvels et al. (2021), der Häufigkeit und Anzahl der Symptome in einem Wert von 0 (keine Symptome) bis 54 (alle Symptome in jedem Zyklus) zusammenfasst.
Detaillierte Ergebnisse und Statistiken:
- Allgemeine Prävalenz von Symptomen:
Von den 15 Spielerinnen ohne hormonelle Verhütung (non-HC) gaben100% (n=15) an, mindestens einmal unter „stomach cramps“ (Bauchkrämpfen) gelitten zu haben. Dies war das absolut häufigste Symptom. Es folgten „sleep disturbances“ (Schlafstörungen) und „tiredness“ (Müdigkeit/Erschöpfung), die jeweils von 73,3% (n=11) der Spielerinnen berichtet wurden. Die Studie stellt fest: „Die am häufigsten auftretenden Symptome bei allen Spielerinnen ohne hormonelle Verhütung […] waren ‘Bauchkrämpfe’, ‘Schlafstörungen’ und ‘Müdigkeit’.“ Das am seltensten genannte Symptom war „nausea“ (Übelkeit), das nur bei einer einzigen Athletin auftrat. - Symptomhäufung in den Zyklusphasen:
Die Studie berechnete vier Zyklusphasen und fand einen deutlichen Anstieg der Symptommeldungen während der Menstruation.„Die Gesamtzahl der Symptommeldungen war während der ‘Menstruation’ (0,79 Symptome pro Tag) am höchsten, gefolgt von der ‘späten Lutealphase’, der ‘follikulären Phase’ und der ‘Lutealphase’ (0,08 Symptome pro Tag).“ Konkret traten 13 der 18 Symptome am häufigsten in der Menstruationsphase auf. - Große individuelle Unterschiede und der MSI:
Die durchschnittliche Anzahl der gemeldeten Symptome pro Zyklus lag bei11,8 (±17,7). Der daraus berechnete durchschnittliche MSI für das Team (non-HC) betrug 12,9 (±10,7) Punkte. Die Bandbreite war jedoch enorm: Die niedrigsten individuellen MSI-Werte lagen bei 1 Punkt (VB06), die höchsten bei 34 Punkten (VB15) und 33 Punkten (VB16). Dies unterstreicht die Aussage der Studie, dass „Menstruationszyklus-Symptome innerhalb eines professionellen Sportteams sehr individuell sein können.“ - Spielerinnen mit hormoneller Verhütung (HC):
Auch die vier Athletinnen, die hormonell verhüteten (z.B. mit Pille, Vaginalring oder Hormonspirale), berichteten von regelmäßigen Symptomen. Der für sie äquivalent berechnete MSI lag im Durchschnitt bei11,05 (±4,7) Punkten. Die Autor:innen folgern daraus, dass auch HC-Nutzerinnen nicht symptomfrei sind, betonen aber gleichzeitig, dass der MSI eigentlich nur für eumenorrhoische Athletinnen validiert ist. Sie stellten fest: „Alle vier HC-Nutzerinnen berichteten regelmäßig über Symptome.“ - Zyklusunregelmäßigkeiten:
Die Studie dokumentierte eine große Varianz in der Zykluslänge. Bei den non-HC-Athletinnen reichte die durchschnittliche Zykluslänge von23,0 (±6,0) Tagen bis hin zu 64,7 (±21,6) Tagen. Nur 6 der 20 Athletinnen hatten einen stabilen Zyklus zwischen 25 und 35 Tagen. Eine Spielerin (VB18) hatte in der vier-monatigen Tracking-Periode überhaupt keinen vollständigen Zyklus, was auf eine Amenorrhoe hindeuten könnte.
Studie 2: Die russische Interventionsstudie – Gezieltes Training steigert die psychische Gesundheit
Die Studie „Volleyball players’ mental health improvement trainings customized to ovarian menstrual cycle“ (Baykovsky et al.) hatte ein klares Ziel: die Entwicklung und Überprüfung eines an den Ovarialzyklus angepassten Trainingssystems zur Verbesserung der psychischen Gesundheit.
Methodik im Detail:
- Teilnehmerinnen:24 Volleyballerinnen (18-20 Jahre) aus zwei Moskauer Super-Liga-Teams.
- Design:6-monatiges Experiment mit Kontrollgruppe (KG, n=12) und Experimentalgruppe (EG, n=12).
- Intervention:
- KG:Trainierte durchgängig ohne Anpassung der Intensität.
- EG:Trainierte mit einem differenzierten Plan. In den als „problematisch“ definierten Phasen (prämenstruell, menstruell und ovulatorisch) wurden die physischen und mentalen Belastungen „so weit wie möglich reduziert und durch technisch-taktische Übungen ersetzt.“ Hohe Intensitäten wurden gezielt in der postmenstruellen und postovulatorischen Phase
- Messinstrumente:Gissen-Fragebogen (subjektive Beschwerden), WAM-Fragebogen (Wohlbefinden, Aktivität, Stimmung) und ein mentaler Gesundheitstest.
Detaillierte Ergebnisse und Statistiken:
- Reduktion körperlicher Beschwerden:
Die EG zeigte nach dem Interventionszeitraum eine signifikante Verringerung subjektiv empfundener Schmerzen und Beschwerden. Die stärksten Unterschiede zur KG fanden sich bei Beschwerden des Reproduktionstrakts (t=2,7; p=0,01), gefolgt von Erschöpfung (t=2,8; p<0,01), Gelenkschmerzen (t=2,4; p=0,05) und Magenschmerzen (t=2,2; p<0,05). Die Forscher:innen folgern:„Die Abschwächung der physischen und mentalen Belastungen in den ‘problematischen’ Phasen des ovariellen Menstruationszyklus durch taktisches Training führt zu einer Verringerung des Ausmaßes von Beschwerden/Schmerzen im Körper der Athletinnen.“ - Verbesserung von Wohlbefinden, Aktivität und Stimmung (WAM):
Die Werte im WAM-Fragebogen waren in der EG nach der Intervention signifikant besser als in der KG (t=2,4-2,8; p<0,05-0,01). Besonders dieAktivität verbesserte sich stark (EG: ~54,3 Punkte vs. KG: ~48,7 Punkte; t=2,2; p<0,05). Die Studie hält fest: „Die WAM-Werte waren signifikant besser als in der KG (t=2,4-2,8; p<0,05-0,01).“ - Signifikante Verbesserung der psychischen Gesundheit:
Die zentralen Ergebnisse lieferte der mentale Gesundheitstest:- Konstruktivität (Skala A):Die EG erreichte mit 53,86 ± 3,42 Punkten einen signifikant höheren Wert als die KG mit 44,03 ± 3,12 Punkten (t=2,13; p<0,05). Ein höherer Wert zeigt eine bessere Fähigkeit, mit hohen Belastungen und psychischer Anspannung umzugehen.
- Destruktivität (Skala B) und Defizienz (Skala C):Hier schnitt die KG signifikant schlechter ab (B: 26,79 vs. 21,12; C: 25,51 vs. 19,52; jeweils p<0,05). Die Studie interpretiert dies als Ausdruck negativer psychischer Veränderungen: „Der Anstieg der Destruktivitäts- und Defizienz-Indizes in der KG […] wurde als Zeichen negativer Veränderungen in der Psyche der Probandinnen interpretiert, die mit übermäßiger Empfindlichkeit gegenüber Kritik, Konfliktneigung, Nervosität, Reizbarkeit und verbaler Aggression einhergingen.“
Dieser positive Effekt in der EG wird von den Autor:innen als „psychoresistenter Effekt“bezeichnet, da das angepasste Training die Widerstandsfähigkeit der Athletinnen gegen die stressenden Auswirkungen der Trainingsbelastungen erhöht habe. Die Studie kommt zu dem Schluss: „Die erhobenen Daten deuteten auf eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit bei den Volleyballerinnen der KG hin, die von einem verringerten ‘psychoresistenten Effekt’ in den problematischen Phasen des Zyklus begleitet wurde.“ Das Fazit der Studie ist klar: „Das an den ovariellen Menstruationszyklus angepasste Trainingssystem erwies sich als vorteilhaft für den Erhalt der psychischen Gesundheit der Volleyballerinnen.“
Gegenüberstellung und Kritik
|
Aspekt |
Deutsche „Tracking“-Studie (Roffler et al.) |
Russische „Interventions“-Studie (Baykovsky et al.) |
|
Fokus & Stärke |
Real-World-Beobachtung über eine lange Dauer. Zeigt die enorme individuelle Variabilität und Alltagsrelevanz des Themas in einem Profi-Team auf. |
Experimenteller Nachweis einer Ursache-Wirkung-Beziehung. Zeigt, dass eine gezielte Intervention das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit verbessern kann. |
|
Schwächen & Limitationen |
• Keine hormonelle Validierung: Die Zyklusphasen wurden nur kalendar geschätzt, nicht hormonell bestätigt. |
• Sehr kleine Stichprobe: Mit n=12 pro Gruppe sind die Ergebnisse statistisch anfälliger. |
Zusammengefasste Empfehlungen für die Praxis
Für Volleyballerinnen:
- Tracke deinen Zyklus!Nutze Apps oder einen Kalender, um ein Bewusstsein für deinen individuellen Rhythmus und deine Symptome zu entwickeln. Du bist nicht „normal“, du bist dein eigenes Normal.
- Kommuniziere deine Beobachtungen!Sprich mit deinen Trainer:innen und dem medizinischen Personal. Zeige ihnen vielleicht sogar deine getrackten Daten, um deine Bedürfnisse zu untermauern. Die deutsche Studie sieht darin einen Vorteil: „Durch das Tracking des Menstruationszyklus können Athletinnen personalisierte Gesundheitspläne entwickeln, um ihr Wohlbefinden und ihren Komfort zu steigern.“
- Passe dein Verhalten an:Plane in den Tagen vor und während der Menstruation mehr Schlaf und Erholung ein. Achte auf eine entzündungshemmende Ernährung (viel Gemüse, Omega-3-Fettsäuren) und reduziere Zucker und verarbeitete Lebensmittel.
Für Trainer:innen und Betreuer:innen:
- Fördere eine offene Kultur:Nehmt das Thema proaktiv in die Teambesprechungen auf. Schafft Vertrauen und signalisiert Verständnis. Die deutsche Studie stellt fest: „Die Kommunikation über die Menstruation zwischen Trainer:innen und Athletinnen scheint immer noch unzureichend zu sein.“
- Denke individuell und flexibel:Erkenne an, dass jede Spielerin einen anderen Zyklus und andere Symptome hat. Biete flexible Trainingsanpassungen an, statt ein starres Schema überzustülpen.
- Nutze die Hochphasen:Plane besonders intensive und kraftraubende Einheiten vorzugsweise in die Zeit nach der Menstruation (follikulare Phase), in der viele Spielerinnen über mehr Energie verfügen.
- Werte die „Problemphasen“ um:Siehe die Menstruation nicht als Krankheit, sondern als eine Phase, in der technisch-taktisches Training oder regenerative Einheiten im Vordergrund stehen können – genau wie in der russischen Studie erfolgreich praktiziert. Die Studie zeigt, dass dies nicht nur dem Körper, sondern auch der Psyche hilft.
Fazit:
Beide Studien liefern wertvolle, sich ergänzende Beiträge. Die deutsche Studie macht die Problemstellung und ihre individuelle Komplexität im Profisport sichtbar. Die russische Studie zeigt einen konkreten Lösungsweg auf und belegt, dass ein zyklusangepasstes Training nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern vor allem auch die psychische Gesundheit und Stresstoleranz signifikant verbessern kann. Der Weg zu einem modernen, geschlechtssensiblen Volleyballtraining führt über Tracking, Kommunikation und individuelle, flexible Anpassungen.
Disclaimer
Die Inhalte dieses Artikels dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keinen Ersatz für eine medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung dar. Zyklusbasiertes Training und alle beschriebenen Empfehlungen können individuell unterschiedlich wirken. Bei gesundheitlichen Beschwerden, Unsicherheiten oder Fragen zu deinem Zyklus, deiner Trainingssteuerung oder deinem allgemeinen Wohlbefinden solltest du immer eine*n Arzt/Ärztin oder andere qualifizierte medizinische Fachpersonen konsultieren.
Trainings- oder Ernährungsanpassungen erfolgen auf eigene Verantwortung.
Quellennachweise
- Rofer A, Fleddermann M-T, de Haan H,Krüger K and Zentgraf K (2024) Menstrual cycle tracking in professional volleyball athletes. Front. Sports Act. Living:1408711. doi: 10.3389/fspor.2024.1408711
- Baykovsky, Yu. V., Aleshicheva, A. V., Samoylov, N. G., Kazakov, D. A. Volleyball players’ mental health improvement trainings customized to ovarian menstrual cycle. Veröffentlicht in Theory and Practice of Physical Culture (2020)

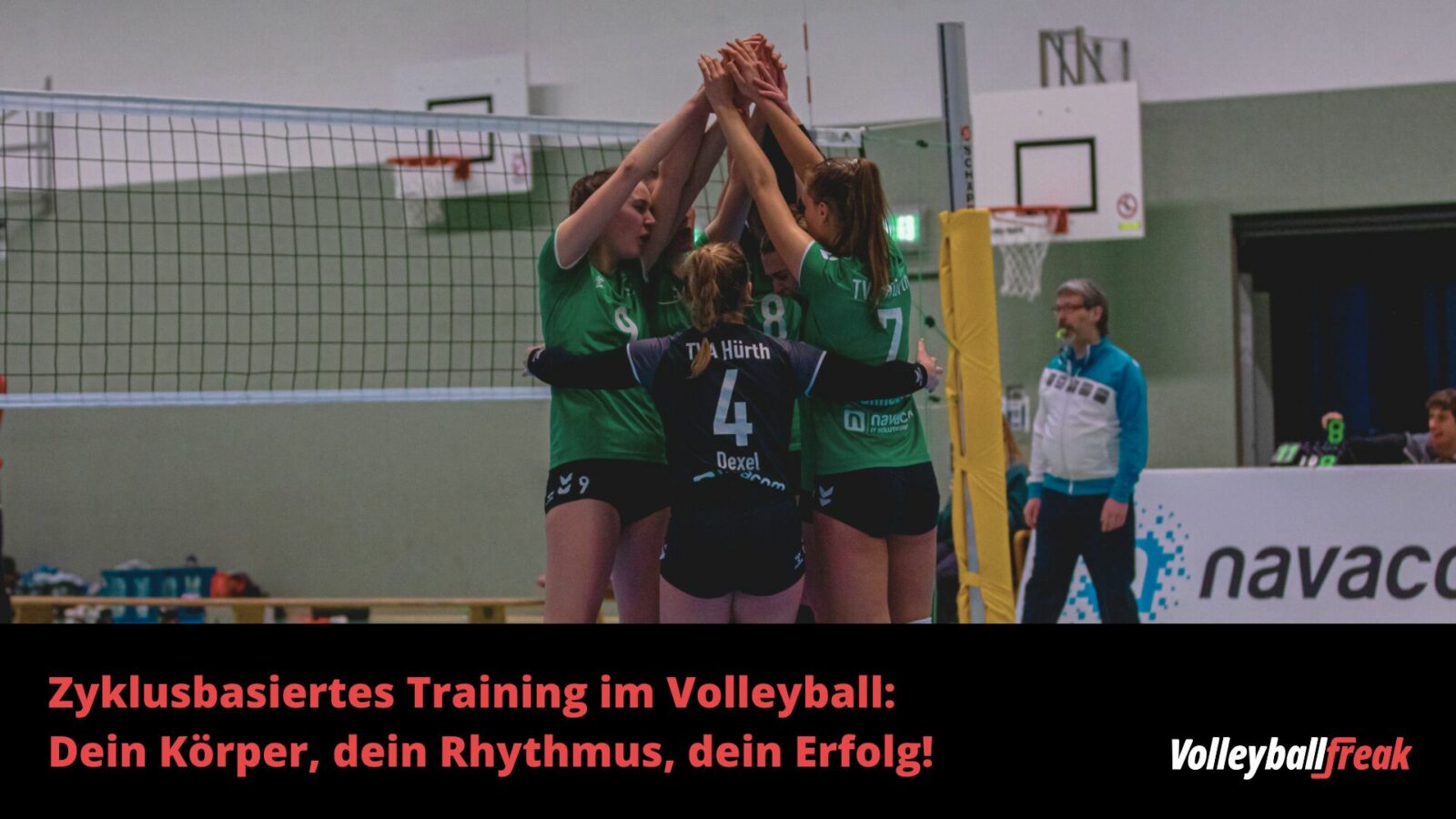
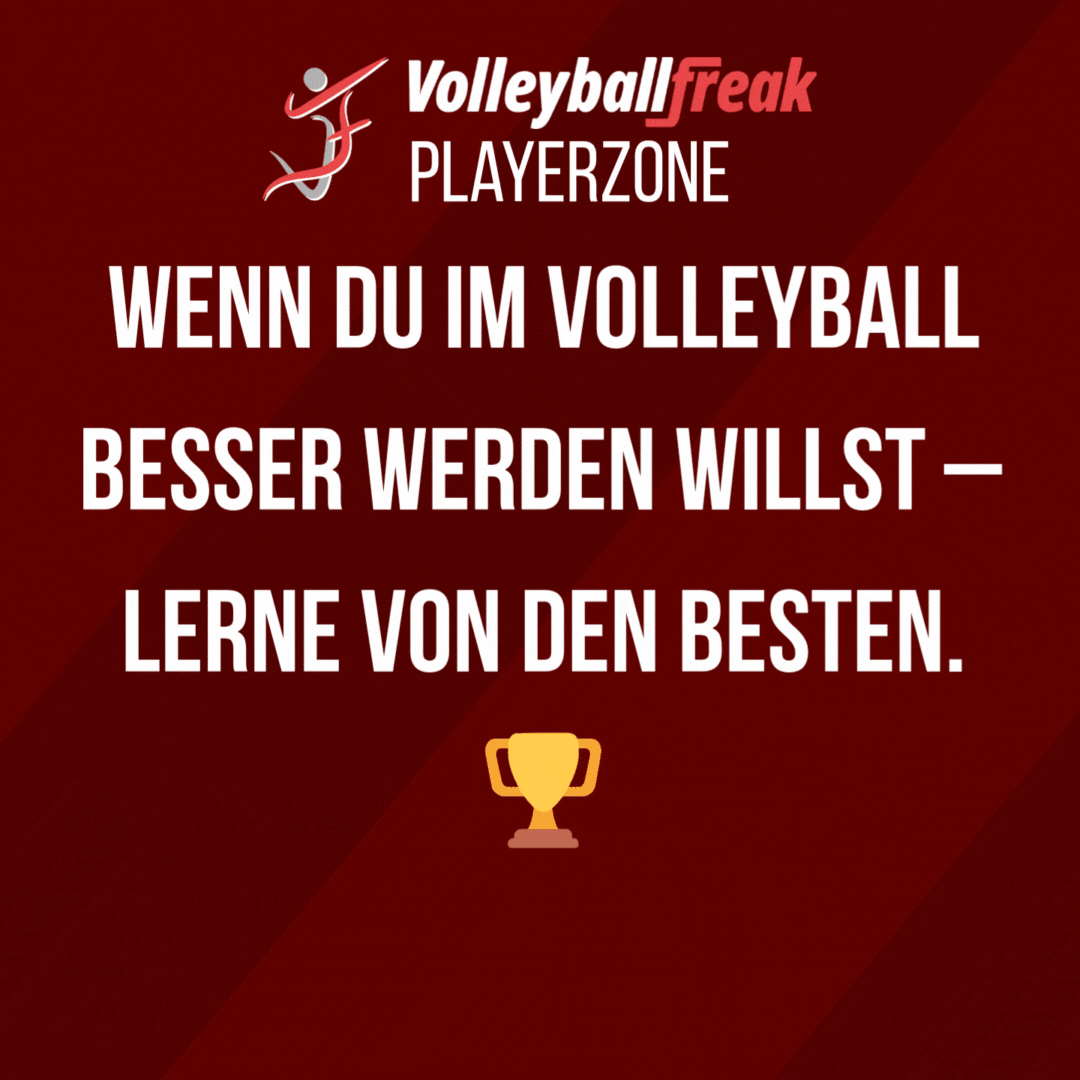

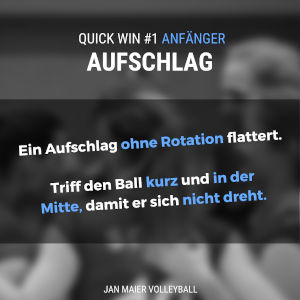
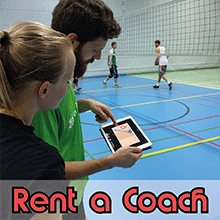



 Mein Name ist Steffen Probst. Ich bin ein leidenschaftlicher Volleyballer, Schiedsrichter und Fan.
Mein Name ist Steffen Probst. Ich bin ein leidenschaftlicher Volleyballer, Schiedsrichter und Fan.